| 1. | 1111111... | Nicht zufällig, da es nur eine mögliche Ziffer gibt. |
| 2. | 123123123... | Nicht zufällig, da periodisch vorhersagbar ist. |
| 3. | 141592653 | Nicht zufällig, da Bildungsregel ersichtlich. |
| 4. | 937393793... | Nicht zufällig, da nur die Ziffern 9, 3 und 7 vorkommen. |
| 5. | 1234567890... | ist nicht zufällig, da zwar alle Ziffern (statistisch) gleich häufig vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, das die 8 hinter der 7, die 7 hinter der 6, usw. kommt 100% ist. |
| xn = (a xn-1 + b) mod m |
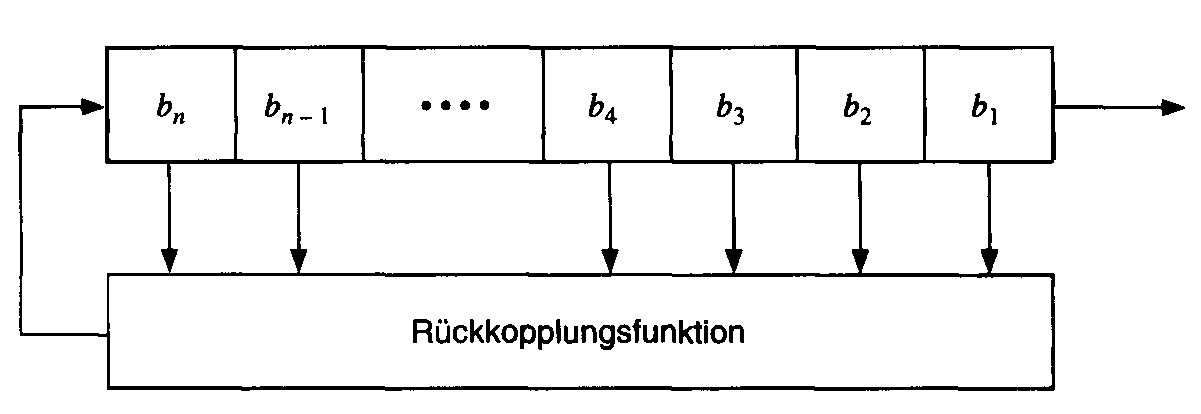 Schieberegister mit Rückkopplung [4]
Schieberegister mit Rückkopplung [4]| A | B | A XOR B |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
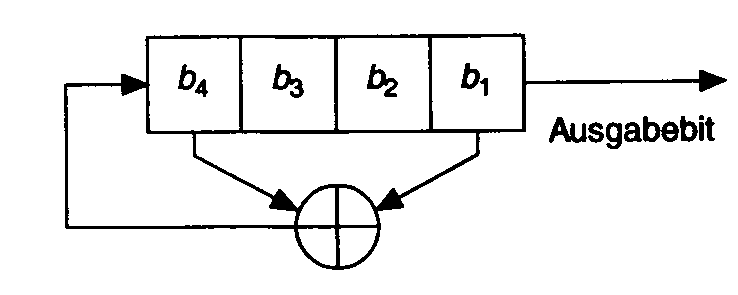 4-Bit-LFSR [4]
4-Bit-LFSR [4]| [1] | RFC 1750 - Randomness Recommendations for Security http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1750.html |
| [2] | How to Generate Pure Random Numbers http://www.javanet.com/~othello/random.htm |
| [3] | Linear Congruence Generators http://pw2.netcom.com/~gfull/lincong.htm |
| [4] | Angewandte Kryptographie, 2. Auflage ISBN 3-89319-854-7 |
| [5] | Congruential Generators http://csep1.phy.ornl.gov:80/rn/node9.html |